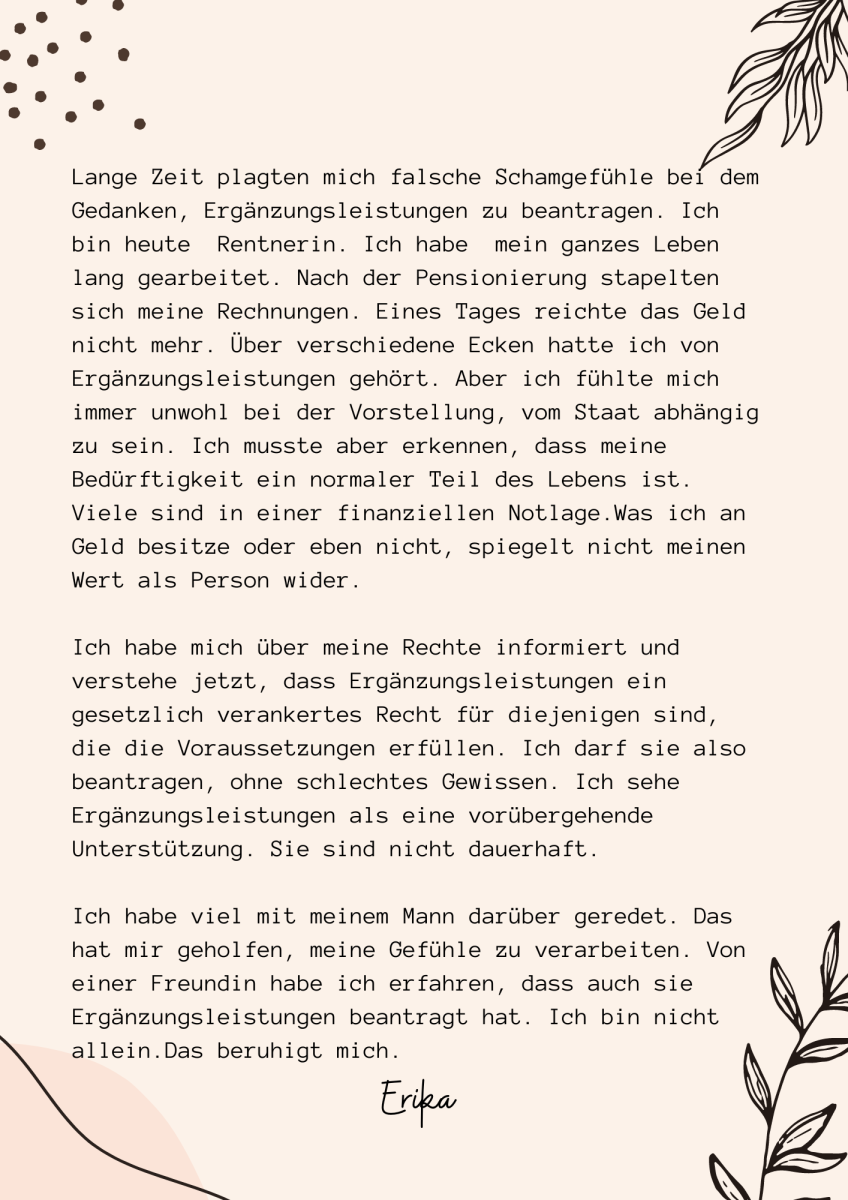Warum Sie sich nicht schämen sollten, Ergänzungsleistungen zu beantragen
Was sind Ergänzungsleistungen | Ergänzungsleistungen berechnen | Höhe Ergänzungsleistungen | Wer hat Anspruch | Wenn Vermögen vorhanden ist | Antrag stellen | Ergänzungsleistungen zurückbezahlen | Schamgefühle überwinden
In der Schweiz bieten Ergänzungsleistungen eine finanzielle Unterstützung für Personen, deren AHV- oder IV-Rente nicht ausreicht, um ihre minimalen Lebenskosten zu decken. Diese Unterstützung wird durch monatliche Beiträge gewährleistet, die auch Krankheits- und Behinderungskosten abdecken, solange sie nicht bereits durch andere Versicherungen gedeckt sind. Viele schämen sich jedoch, Ergänzungsleistungen zu beantragen. Wie Sie Schamgefühle überwinden und wie Sie Ergänzungsleistungen beantragen, erfahren Sie in diesem Artikel.

Nach einer langen Berufslaufbahn als Elektromonteur geniesst Hans Meier nun seinen Ruhestand. Doch trotz jahrzehntelanger Arbeit stellt er fest, dass seine AHV-Rente nicht ausreicht, um seinen Lebensunterhalt zu decken; regelmäßig befindet sich sein Konto am Monatsende im Minus, da seine Ausgaben die Einnahmen übersteigen. Glücklicherweise steht Hans Meier nicht alleine da. Er könnte Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL) haben, die ihm finanzielle Unterstützung bieten und somit zu einer Verbesserung seiner finanziellen Situation im Ruhestand beitragen könnten.
Was sind Ergänzungsleistungen in der Schweiz?
Ergänzungsleistungen helfen Personen, wenn sie mit ihrer AHV- oder IV-Rente ihre minimalen Lebenskosten nicht decken können. Es sind finanzielle Beiträge, die monatlich ausbezahlt werden, um den Betroffenen ihr Existenzminimum zu sichern. Die Beiträge vergüten zudem Krankheits- und Behinderungskosten.
Krankheits- und Behinderungskosten
Personen, die Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben, können zusätzlich Krankheits- und Behinderungskosten zurückerstatten lassen. Die Kosten erhält man aber nur zurück, wenn sie nicht schon durch eine Versicherung wie Krankenkasse, Unfall-, Haftpflicht- oder Invaliditätsversicherung übernommen wurden.
Wie werden Ergänzungsleistungen berechnet?
Die Berechnung der jährlichen Ergänzungsleistungen erfolgt individuell und berücksichtigt die spezifische wirtschaftliche Lage sowie persönliche Umstände des Antragstellers. Vereinfacht ausgedrückt, resultiert der Betrag aus den verfügbaren Einnahmen, wie beispielsweise der Rente, minus den regelmässigen Ausgaben, zu denen unter anderem die Bruttomiete zählt.
Wer hat Anspruch auf Ergänzungsleistungen?
Die wichtigste Voraussetzung ist: Die Person bezieht eine AHV- oder IV-Rente oder ein IV-Taggeld für mindestens sechs Monate.
Zusätzlich muss die Person:
- in der Schweiz wohnen
- höhere Ausgaben als Einnahmen haben
- wenn sie eine ausländische Staatsangehörigkeit hat, eine gültige Aufenthaltsbewilligung besitzen und seit zehn Jahren in der Schweiz leben
- wenn sie geflüchtet oder staatenlos ist und mindestens fünf Jahre in der Schweiz leben.
Beeinflusst Vermögen die Höhe der Ergänzungsleistungen?
Ja. Personen, die mehr als 100000 Franken besitzen, können keine Ergänzungsleistung beantragen. Die Obergrenze bei Ehepaaren liegt bei 200000 Franken, bei Kindern 50000 Franken. Nicht inbegriffen ist der Besitz von Häusern und Wohnungen, die man selbst bewohnt. Ferienwohnungen und vermietete Liegenschaften werden hingegen angerechnet.
Wenn Sie auf einen Teil Ihres Vermögens verzichten, kann dies bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen berücksichtigt werden. Ein Verzicht auf Vermögen bedeutet, dass Sie etwas von Wert verkauft oder verschenkt haben, ohne dafür etwas Gleichwertiges oder eine Pflicht dazu zu haben.
Beispiele:
- Wenn Sie mehr als 100 000 Franken besitzen: Wenn Sie innerhalb eines Jahres mehr als 10 % Ihres Vermögens ausgeben, wird der Betrag, der diese 10 % übersteigt, als Vermögensverzicht betrachtet.
- Wenn Sie weniger als 100 000 Franken besitzen: Wenn Sie mehr als 10 000 Franken in einem Jahr ausgeben, wird dieser Betrag als Vermögensverzicht angesehen. Es gibt jedoch Ausnahmen. Wenn Sie Geld für wichtige Dinge ausgeben, wie Ihren Lebensunterhalt, die Instandhaltung Ihrer Immobilie oder berufliche Weiterbildungen, wird dieser Betrag nicht als Vermögensverzicht gerechnet.
Wie hoch sind die Ergänzungsleistungen?
Die Höhe der Ergänzungsleistungen hängt von verschiedenen Faktoren ab und ist darauf ausgerichtet, die Differenz zwischen den anerkannten Ausgaben und den anrechenbaren Einnahmen einer Person oder eines Haushalts zu decken. Die anerkannten Ausgaben umfassen insbesondere den Grundbedarf für den Lebensunterhalt, Mietzins, Kranken- und Pflegeversicherungsprämien sowie gegebenenfalls weitere spezifische Auslagen. Die anrechenbaren Einnahmen beinhalten Renten, Einkünfte aus Erwerbstätigkeit und Vermögen sowie weitere Einkommensarten.
- Grundbedarf für den Lebensunterhalt: Dieser Betrag ist gesetzlich festgelegt und variiert je nach Lebenssituation. Für das Jahr 2023 beträgt der monatliche Grundbedarf für Einzelpersonen 1230 Franken und für Ehepaare 1845 Franken.
- Maximalbetrag: Die maximale Höhe der EL ergibt sich aus der Summe der anerkannten Ausgaben abzüglich der anrechenbaren Einnahmen. Gibt es eine Differenz, die über dem anrechenbaren Einkommen liegt, wird diese bis zum festgelegten Maximalbetrag durch die EL gedeckt.
- Anpassung an die individuelle Situation: Die tatsächliche Höhe der EL wird individuell berechnet und kann je nach den spezifischen Lebens- und Einkommensverhältnissen stark variieren. Faktoren wie Wohnkanton, Mietkosten und gesundheitliche Bedürfnisse können die Höhe der Leistungen beeinflussen.
Wird die Schenkung an Ergänzungsleistungen angerechnet?
Das Vermögen, auf das eine Person freiwillig verzichtet, zum Beispiel durch eine Schenkung oder einen Erbvorbezug an die Nachkommen, fliesst in die Berechnung von Ergänzungsleistungen mit ein. Als freiwilliger Verzicht werden Ausgaben angesehen von mehr als zehn Prozent des Vermögens pro Jahr.
Ergänzungsleistungen: Wird die Miete angerechnet?
Ab dem Jahr 2021 erleben die Bezieherinnen und Bezieher von Ergänzungsleistungen eine Verbesserung in der Berechnung ihrer zulässigen Mietkosten. Die vormals einheitlichen Pauschalen von 13200 Franken für Einzelpersonen und 15000 Franken für Ehepaare wurden abgeschafft. Stattdessen richtet sich die Mietkostenanrechnung nun nach drei spezifischen Mietregionen, was eine gerechtere Berücksichtigung der tatsächlichen Wohnkosten ermöglicht. Die Zuteilung der einzelnen Gemeinden zu diesen Mietregionen kann in einer detaillierten Aufstellung der Mietzinsregionen eingesehen werden, wodurch Transparenz und Nachvollziehbarkeit für die Betroffenen geschaffen werden.
Nehmen wir das Beispiel einer Familie aus der Mietregion 1: Ein Ehepaar hat drei Kinder. Bei der Kalkulation des Mietzinsmaximums wird hier der Tarif für eine vierköpfige Familie angewandt. Dies bedeutet, dass nun jährlich bis zu 25 200 Franken für die Miete angerechnet werden können, im Gegensatz zu den vorherigen 15 000 Franken.
Wann beginnt der Anspruch auf Ergänzungsleistungen?
Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL) in der Schweiz wird hauptsächlich durch das Erreichen des Rentenalters, das bei Frauen 64 und bei Männern 65 Jahre beträgt, und die finanzielle Bedürftigkeit ausgelöst. Personen können allerdings auch vor dem Erreichen des ordentlichen Rentenalters Anspruch auf EL haben, insbesondere wenn sie bereits Invalidenversicherungsleistungen beziehen.
Wie beantragt man Ergänzungsleistungen?
Die Beantragung von Ergänzungsleistungen erfolgt in mehreren Schritten, die darauf abzielen, finanzielle Unterstützung für Personen zu gewährleisten, deren Renten und Einkommen nicht ausreichen, um die minimalen Lebenskosten zu decken.
- Informieren: Zuerst sollten Sie sich über die Voraussetzungen für Ergänzungsleistungen informieren. Die offizielle Webseite der AHV/IV bietet detaillierte Informationen zu den Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um Anspruch auf EL zu haben.
- Antragsformular besorgen: Das Antragsformular für Ergänzungsleistungen kann online auf der Webseite der AHV/IV heruntergeladen oder bei der zuständigen Ausgleichskasse in Ihrem Wohnkanton angefordert werden. Einige Kantone bieten das Formular auch direkt auf ihren Webseiten an.
- Dokumente sammeln: Für den Antrag müssen diverse Unterlagen beigelegt werden, darunter Nachweise über Einkommen und Vermögen, Mietkosten, Kranken- und Pflegeversicherungsprämien sowie Angaben zu weiteren finanziellen Verpflichtungen. Die genaue Liste der benötigten Dokumente finden Sie in den Antragsunterlagen oder online.
- Antrag ausfüllen: Füllen Sie das Antragsformular sorgfältig aus. Geben Sie alle erforderlichen Informationen wahrheitsgetreu an und achten Sie darauf, dass der Antrag vollständig ist, um Verzögerungen zu vermeiden.
- Antrag einreichen: Senden Sie den ausgefüllten Antrag zusammen mit allen erforderlichen Belegen an die Ausgleichskasse Ihres Wohnkantons. Die Adresse der zuständigen Stelle finden Sie im Antragsformular oder online.
- Bearbeitung und Entscheidung: Nach Einreichung wird Ihr Antrag von der Ausgleichskasse geprüft. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Falls erforderlich, kann die Kasse weitere Informationen oder Dokumente anfordern. Nach Abschluss der Prüfung erhalten Sie einen Entscheid über Ihren Antrag.
- Widerspruch: Sollten Sie mit dem Entscheid nicht einverstanden sein, haben Sie das Recht, innerhalb einer bestimmten Frist Widerspruch einzulegen. Die genauen Bedingungen und Fristen für einen Widerspruch entnehmen Sie bitte dem Entscheidungsbrief.
Onlinerechner: Berechnen Sie Ihren Anspruch auf Ergänzungsleistungen
Wer wissen möchte, ob er einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen hat, kann dies online mit einem Rechner herausfinden. Die Berechnung ist keine Anmeldung. Der Rechner richtet sich an Personen, die zu Hause wohnen. Zum Rechner geht es hier lang. Wer in einem Heim wohnt, sollte sich an die Heimleitung wenden, die einen über die Ergänzungsleistungen informieren.

Müssen Ergänzungsleistungen zurückbezahlt werden?
Ja. Es gibt klare Regelungen darüber, wann und in welchem Umfang Ergänzungsleistungen zurückgezahlt werden müssen. Die Rückzahlungspflicht lässt sich in zwei Kategorien einteilen:
Korrektur unrechtmässig bezogener Leistungen:
Sollten sich im Nachgang ergeben, dass Sie während des Bezugs von EL über mehr Vermögen verfügten als ursprünglich angegeben, ergibt sich eine Rückzahlungspflicht. Hierbei handelt es sich um den Betrag, der Ihnen basierend auf den ursprünglichen, nun aber korrigierten Angaben, zu viel ausgezahlt wurde.
Rückerstattungspflicht nach dem Tod des Leistungsbeziehers
Nach dem Ableben einer EL-beziehenden Person kann eine Rückerstattungspflicht für die Erben entstehen. Diese bezieht sich auf EL, die in den zehn Jahren vor dem Todesfall bezogen wurden. Allerdings wird die Rückerstattung nur fällig, wenn das Vermögen des Verstorbenen 40 000 Franken übersteigt. Dabei ist ausschliesslich das Vermögen zum Zeitpunkt des Todes massgebend. Diese Regelung gilt nur für EL, die nach dem 1. Januar 2021 ausgezahlt wurden. Bei verheirateten Paaren tritt die Rückerstattungspflicht erst nach dem Tod beider Partner in Kraft. Hierbei ist das gemeinschaftliche Vermögen zum Zeitpunkt des Todes des zuletzt verstorbenen Partners relevant.
Erben werden zur Kasse gebeten
Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2021 sind Erben verpflichtet, bezogene Ergänzungsleistungen des Verstorbenen zurückzuzahlen, falls diese in vorangegangenen Jahren rechtmässig empfangen wurden, und der Wert des Nachlasses mehr als 40 000 Franken übersteigt. Für Nachlässe, die diesen Betrag nicht erreichen, entfällt die Rückzahlungspflicht.
Diese Neuregelung führt zu einer erhöhten Komplexität in der Abwicklung von Erbschaften. Daher ist es ratsam, diese Änderung bei der Planung des eigenen Nachlasses zu berücksichtigen, um unvorhergesehene Verpflichtungen für die Erben zu vermeiden.

Ich schäme mich, Ergänzungsleistungen zu beantragen
Das Empfinden von Scham beim Beantragen von Ergänzungsleistungen ist ein tief verwurzeltes Phänomen, das oft durch gesellschaftliche Vorstellungen von Selbstständigkeit und finanzieller Unabhängigkeit verstärkt wird. Viele Menschen sehen das Aufsuchen staatlicher Unterstützung als ein Zeichen persönlichen Scheiterns oder mangelnder Eigenverantwortung. Diese Wahrnehmung wird durch das soziale Stigma verstärkt, das mit dem Bezug von Sozialleistungen verbunden ist, und kann zu Gefühlen von Scham und Unwürdigkeit führen. Darüber hinaus spielen auch tief sitzende Überzeugungen bezüglich Stolz und der Angst vor sozialer Abwertung eine Rolle, wodurch sich Einzelne davor scheuen, ihre finanzielle Notlage öffentlich zu machen oder offiziell anzuerkennen, dass sie staatliche Hilfe benötigen. Dieses Zögern, Unterstützungsangebote in Anspruch zu nehmen, spiegelt nicht nur persönliche Ängste wider, sondern auch eine gesellschaftliche Herausforderung, den Wert und die Akzeptanz von Sozialleistungen als legitimen und notwendigen Teil sozialer Sicherungssysteme zu stärken.
Die Scham, Ergänzungsleistungen zu beantragen, betrifft viele in der Schweiz. Rund 230 000 ältere Menschen in der Schweiz, die Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben, beziehen diese nicht. Dies geht aus einer Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften für Pro Senectute hervor. Hauptgründe für den Nichtbezug sind mangelndes Wissen, Angst, Scham und bürokratische Hürden. Besonders betroffen sind Frauen, Verwitwete, ausländische Staatsangehörige und Personen ohne höhere Bildung, wobei ein Grossteil in ländlichen Gebieten lebt.
Wie überwinde ich meine Scham, Ergänzungsleistungen zu beantragen?
Das Überwinden von Schamgefühlen bei der Beantragung von Ergänzungsleistungen erfordert einen Perspektivenwechsel und einige bewusste Schritte, um die negativen Emotionen zu adressieren. So gelingt Ihnen die Überwindung:
Verstehen, dass Bedürftigkeit normal ist
Erkennen Sie an, dass jeder Mensch in seinem Leben Phasen der Bedürftigkeit durchlaufen kann. Wirtschaftliche Schwierigkeiten oder finanzielle Notlagen sind Teil des menschlichen Lebens und spiegeln nicht Ihren Wert als Person wider.
Informieren Sie sich über Ihre Rechte
Verstehen Sie, dass Ergänzungsleistungen ein gesetzlich verankertes Recht für diejenigen sind, die die Voraussetzungen erfüllen. Diese Leistungen sind Teil des sozialen Sicherheitsnetzes, das dazu dient, allen Bürgerinnen und Bürgern ein würdevolles Leben zu ermöglichen.
Sehen Sie Ergänzungsleistungen als vorübergehende Unterstützung
Betrachten Sie die Inanspruchnahme von Ergänzungsleistungen nicht als dauerhaften Zustand, sondern als vorübergehende Hilfe, die Ihnen ermöglicht, eine schwierige Lebensphase zu überbrücken.
Sprechen Sie mit anderen
Oft hilft es, mit Vertrauenspersonen über Ihre Situation und Gefühle zu sprechen. Manchmal kann das Teilen Ihrer Bedenken mit anderen Ihnen helfen, Ihre Gefühle zu validieren und zu verarbeiten.
Beratung in Anspruch nehmen
Es gibt Organisationen, die kostenlose Beratung und Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen anbieten. Fachleute können Sie nicht nur im Prozess unterstützen, sondern auch dazu beitragen, Ihre Schamgefühle zu mindern.
Fokussieren Sie auf das positive Ergebnis
Konzentrieren Sie sich darauf, wie die finanzielle Unterstützung durch Ergänzungsleistungen Ihre Lebensqualität verbessern kann, statt auf die negativen Gefühle wie Existenzangst und Einsamkeit, die mit dem Beantragungsprozess verbunden sein könnten.
Entwickeln Sie eine positive Selbstsicht
Arbeiten Sie daran, Ihre Selbstwahrnehmung zu stärken und sich selbst nicht für Umstände zu verurteilen, die oft ausserhalb Ihrer Kontrolle liegen.
Betrachten Sie es als einen Akt der Selbstfürsorge
Die Beantragung von Ergänzungsleistungen ist ein Schritt, um für sich selbst und möglicherweise für Ihre Familie zu sorgen. Es ist ein verantwortungsbewusster Akt, der notwendig ist, um Wohlbefinden und Stabilität zu sichern.