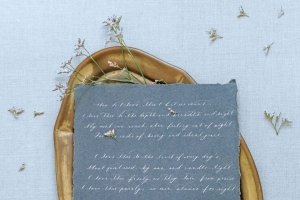Trauerbewältigung: Was nach dem Tod eines geliebten Menschen hilft
Fast jeder Mensch durchläuft nach dem Verlust eines geliebten Menschen Phasen der Trauer, die von Leugnen über Zorn bis hin zur Akzeptanz reichen. Doch wie verarbeitet man diesen Schmerz und findet zurück ins Leben? Dieser Artikel bietet Einblicke in den Prozess der Trauerbewältigung, gibt praktische Tipps und zeigt, wie professionelle Therapie helfen kann. Auch besondere Themen wie die speziellen Herausforderungen erwachsener Kinder nach dem Tod eines Elternteils oder der schmerzliche Verlust einer Mutter werden beleuchtet.

Trauerbewältigung – das Wichtigste in Kürze:
- Trauerbewältigung ist ein psychologischer Prozess, durch den Personen mit dem Verlust eines geliebten Menschen oder etwas Wertvollem in ihrem Leben umgehen. Was die Trauerbewältigung beinhaltet
- Es gibt fünf «typische» Phasen der Trauer, die Menschen beim Trauern durchlaufen können. Das sind die Phasen
- Eine Therapie kann im Prozess der Trauerbewältigung auf verschiedene Weisen helfen. Das sind die Vorteile
- Einem Freund oder einer Freundin von den eigenen Gefühlen zu erzählen, ist eine wunderbare Möglichkeit, sich auszusprechen und sich zu erleichtern. Das sind die Vorteile
Martha, 65 Jahre alt, steht in ihrer Küche, umgeben von Stille, die nur durch das leise Ticken der Wanduhr durchbrochen wird. Sie hält ein altes Foto ihrer Mutter in der Hand, das sie beim Aufräumen gefunden hat. Obwohl die Tränen in ihren Augen schimmern, kann sie sie nicht fliessen lassen. Mit dem Verlust ihrer Mutter fühlt sie sich verloren und unsicher, wie sie trauern soll. Die Kirche, einst ein Anker für Trauernde in ihrem Dorf, ist ihr fremd geworden, seit sie vor Jahren ausgetreten ist. Jetzt, in ihrer stillen Küche, ringt sie mit einem Wirrwarr aus Gefühlen – Trauer, Verlust, aber auch eine seltsame Leere. Sie hat das Bedürfnis zu weinen, zu sprechen, ihre Gefühle auszudrücken, findet aber keinen Weg, dies zu tun. Die Kaffeetasse in ihrer Hand wirkt plötzlich so bedeutungslos im Vergleich zu dem Gewicht des Verlustes, das auf ihren Schultern lastet.
Definition: Trauerbewältigung, was ist das?
Trauerbewältigung ist ein psychologischer Prozess, durch den Personen mit dem Verlust eines geliebten Menschen oder etwas Wertvollem in ihrem Leben umgehen. Dieser Prozess ist tief persönlich und variiert stark von Person zu Person. Er umfasst verschiedene Phasen, darunter Leugnen, Wut, Verhandeln, Depression und Akzeptanz, wie in Elisabeth Kübler-Ross' Modell beschrieben, obwohl nicht jeder alle Phasen durchläuft oder sie in einer bestimmten Reihenfolge erlebt. Trauerbewältigung beinhaltet das Ausdrücken und Verarbeiten von Emotionen, das Anpassen an das Leben ohne die verstorbene Person und das allmähliche Finden eines Weges, um mit der neuen Realität weiterzuleben. Wichtig ist, dass Trauer ein natürlicher und gesunder Prozess ist, der Unterstützung durch Familie, Freunde, Selbstfürsorge und gegebenenfalls professionelle Hilfe benötigen kann. Ziel der Trauerbewältigung ist es, den Schmerz zu integrieren und letztlich ein Gefühl von Frieden und Akzeptanz zu erreichen.
Trauerbewältigung Methoden: Was sind die fünf Phasen der Trauer?
Die fünf Phasen der Trauer, wie sie von der schweizerisch-US-amerikanischen Psychiaterin und Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross in ihrem Modell beschrieben werden, umfassen:
- Leugnen und Isolierung
- Zorn
- Verhandeln
- Depression und Leid
- Akzeptanz
Diese Phasen repräsentieren nicht eine lineare oder vorhersehbare Abfolge, sondern eher verschiedene Reaktionen und Gefühlszustände, die Menschen während des Trauerprozesses erleben können. Sowohl Sterbende als auch Angehörige durchlaufen demnach dieses Fünf-Phasen-Modell. Die Dauer der Phasen und ihr Intensitätsgrad variiert von Mensch zu Mensch.
Leugnen und Isolierung
Ein lieber Mensch wird sterben. Diese Nachricht erschüttert zutiefst und lässt die Menschen zunächst nicht glauben, was sie gehört haben. Das kann doch nicht wahr sein! ist der vorherrschende Gedanke. Möglicherweise haben Ärzte oder Ärztinnen eine falsche Diagnose getroffen? Es könnte sich um eine Fehlinformation handeln. Diese Hoffnungen sind es, die die betroffene Person und seine Angehörige trösten. Nachfragen und eine zweite Meinung einholen helfen, die Wucht der Nachricht zu mindern.
Zorn
Kein Zweifel besteht! Das ist die Wahrheit. Der baldige Abschied ist nicht zu verhindern. Diese Erkenntnisse machen den sterbenden Menschen und ihren Angehörigen zornig. Oft werden vermeintlich Schuldige gesucht, auf die sich der Zorn richtet. Die Wut ist ein Zeichen dafür, dass wir an dem Menschen hängen, der in Kürze sterben wird oder bereits gestorben ist.
Verhandeln
In dieser Phase steht der Wunsch im Vordergrund, noch etwas mehr gemeinsame Zeit zu haben – vielleicht, um ein wichtiges Ereignis mit der Familie zusammen zu erleben. Sterbende nehmen an Therapien teil; trauernde Angehörige unterstützen dabei. Die Hoffnung steht im Raum, den Tod doch noch abwenden zu können. Angehörige sollten der sterbenden Person die Hoffnung nicht nehmen, sie aber auch nicht schüren.
Depression und Leid
Wenn die Hoffnung schwindet, gehen die Gedanken in die Vergangenheit. Oft betrauern Sterbende, dass Chancen im Leben nicht ausreichend genutzt wurden. Trauernde Angehörige zum Beispiel fragen sich, warum sie Konflikte nicht frühzeitig gelöst oder warum sie nicht mehr qualitativ hochwertige Zeit mit dem sterbenden Menschen verbracht haben. Diese Phase lässt sich nutzen, um sich gegenseitig zu verzeihen und noch einmal liebevoll zusammenzurücken. Angehörige können in dieser Phase einem sterbenden Menschen gut helfen, indem sie ein offenes Ohr für ihn haben und ihm aktiv zuhören.
Akzeptanz
Hat ein sterbender Mensch die Phase der Akzeptanz erreicht, wirkt er oft wie in sich gekehrt. Betreuende und Besuchende können nun einfach still an seiner Seite sein. In dieser Phase ist es gut loszulassen und den Wunsch des geliebten Menschen zu sterben, möglichst zu akzeptieren.
Trauerbewältigung: Tipps – was hilft am besten gegen Trauer?
Trauerbewältigung – diese Tipps helfen:
Mit anderen Menschen sprechen: Einem Freund oder einer Freundin von den eigenen Gefühlen zu erzählen, ist eine wunderbare Möglichkeit, sich auszusprechen und sich zu erleichtern. Die Emotionen werden durch das Öffnen eines Ventils abgelassen.
Aufgaben teilen: Die Aufteilung von Pflichten und die Bereitstellung von Zeit und Ruhe, um sich selbst zu kümmern, helfen bei der Trauerverarbeitung. Wer einen sterbenden Menschen begleitet oder sich nach einem Todesfall um seine Angelegenheiten kümmert, steht häufig auch unter Zeitdruck. Deshalb ist es hilfreich, sich Hilfe zu organisieren. Möglicherweise lassen sich die Betreuung, Begleitung und Aufgaben unter den Angehörigen verteilen?
Wut nicht persönlich nehmen: Natürlich ist es nicht einfach, einen sterbenden Menschen zu ertragen, der nörgelt oder immer wieder Wutausbrüche hat. Es ist leichter, Beleidigungen zu ertragen, wenn man sich daran erinnert, wie enttäuscht oder verzweifelt der andere sein muss. Es hilft, sich kurz aus dem Raum zu entfernen, sich einen Kaffee zu holen und in die Sonne zu blinzeln. Dies kann die eigenen Gefühle wieder beruhigen.
Trauertagebuch führen: In einem Tagebuch kann man alle Gefühle und Gedanken äussern, ohne dass man sich dafür rechtfertigen muss. Es hilft dabei, Emotionen und innere Vorgänge besser zu verstehen und einzuordnen.
Trauer nicht in Alkohol ertränken: Drogen und Tabletten helfen nicht, Trauer zu verarbeiten – sie wird auf diese Weise nur bei Seite geschoben. «Trauer ist notwendig, um den Verlust seelisch zu verarbeiten. Das Ziel des Trauerprozesses ist der endgültige innere Abschied von dem Verstorbenen, die Annahme des Verlustes und die Bereitschaft, sich wieder dem Leben zuzuwenden», erklärt der Psychotherapeut Erhard Trittbach aus Zürich.
Eigene Gefühle akzeptieren: Trauer braucht Zeit und Raum – und auch Geduld, denn wie der Trauerprozess verläuft, ist individuell verschieden.
Sich professionelle Unterstützung holen: Professionelle Begleitung hilft, mit der Trauer besser zurechtzukommen. Sinnvoll ist eine Therapie zum Beispiel dann, wenn die Trauer besonders lange anhält und/oder auch von Gefühlen der Wut, Schuld und von Ängsten begleitet wird oder sich ausweglos erscheinende Einsamkeit einstellt.
Trauerbewältigung: Wie kann eine Therapie helfen?
Eine Therapie kann im Prozess der Trauerbewältigung auf verschiedene Weisen helfen. Sie bietet einen sicheren und unterstützenden Raum, indem Trauernde ihre Gefühle offen ausdrücken und verarbeiten können, ohne Urteile oder Druck von aussen. Ein Therapeut kann dabei helfen, die komplexen Emotionen, die mit dem Verlust einhergehen, zu verstehen und zu akzeptieren, und kann Techniken und Strategien anbieten, um mit den Herausforderungen und Veränderungen, die der Verlust mit sich bringt, umzugehen. Therapie unterstützt auch bei der Entwicklung von Bewältigungsmechanismen und der Anpassung an ein Leben nach dem Verlust, während sie gleichzeitig Raum für das Erinnern und Ehren des Verstorbenen bietet. Ausserdem kann sie hilfreich sein, um etwaige zusätzliche Probleme wie Depressionen oder Angstzustände, die sich aus der Trauer ergeben können, zu adressieren.
Trauerbewältigung: Wer bezahlt die Psychotherapie?
Seit dem 1. Juli 2022 deckt die Grundversicherung in der Schweiz die Kosten für psychologische Psychotherapie, unter der Bedingung, dass diese auf ärztliche Anordnung erfolgt. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten müssen für die Abrechnung mit der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) spezifische Voraussetzungen erfüllen, wie eine kantonale Bewilligung zur Berufsausübung in der Psychotherapie und mindestens drei Jahre klinische psychotherapeutische Erfahrung.
Die Grundversicherung übernimmt zunächst die Kosten für 15 Sitzungen. Bei Bedarf und nach Absprache mit der ärztlichen Fachperson sind weitere 15 Sitzungen möglich. Für eine Fortsetzung der Therapie über diese 30 Sitzungen hinaus ist eine Kostengutsprache des Versicherers erforderlich. Die Anordnung für die Psychotherapie ist auf Ärztinnen und Ärzte der Grundversorgung sowie der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung beschränkt.
Trauerbewältigung: So gehen Kinder mit Trauer um
Auch wenn erwachsene Kinder längst ein unabhängiges Leben führen und in vielen Lebensbereichen Reife und Stärke zeigen, ist der Verlust eines Elternteils oder einer anderen nahestehenden Person oftmals ein tief erschütterndes Erlebnis. Das Gefühl des Schutzes und der Geborgenheit, das Eltern oft ein Leben lang vermitteln, kann plötzlich fehlen. Viele erwachsene Kinder fühlen sich unvorbereitet und stehen erstmals vor der Herausforderung, ohne den Rat oder die Präsenz des verstorbenen Elternteils zurechtzukommen. Zudem können alte Familienrollen und Dynamiken in den Vordergrund treten, die den Trauerprozess komplexer gestalten. Es ist wichtig, dass erwachsene Kinder sich die Erlaubnis geben, zu trauern, Unterstützung suchen, wenn sie diese benötigen, und sich daran erinnern, dass Trauer ein individueller Prozess ist, der Zeit und Raum benötigt.
Trauerbewältigung: Wenn die Mutter gestorben ist
Der Verlust einer Mutter ist eines der tiefgreifendsten und schmerzhaftesten Erlebnisse, das ein Mensch durchmachen kann. Eine Mutter ist oft die erste Bezugsperson im Leben, der Ursprung von Geborgenheit, Liebe und Fürsorge. Wenn sie stirbt, kann sich das anfühlen, als wäre ein wesentlicher Ankerpunkt im Leben plötzlich verschwunden. Es können Gefühle der Leere, des Unverständnisses und der Überforderung auftreten. Oftmals kommen auch alte Erinnerungen und ungeklärte Fragen auf, die im Laufe des Lebens zwischen Mutter und Kind entstanden sind. Das Fehlen der mütterlichen Präsenz bei besonderen Lebensereignissen, wie Hochzeiten, Geburten oder anderen Meilensteinen, kann zusätzlichen Kummer verursachen. Es ist essenziell, sich Zeit zu nehmen, den Schmerz zu verarbeiten und sich Unterstützung zu suchen – sei es im Austausch mit Familienmitgliedern, Freunden, Therapeuten oder mit Hilfe einer professionellen Trauerbegleitung. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, um den Tod der Mutter zu betrauern; wichtig ist, den eigenen Gefühlen Raum zu geben und den Verlust in seinem eigenen Tempo zu verarbeiten.